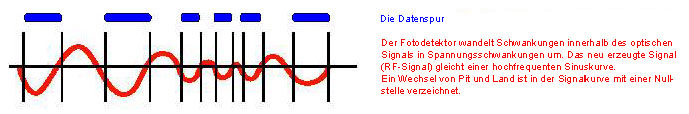3. Das CD-Laufwerk
3.1 Verschiedene Leseverfahren (Vergleich Audio-CD-Player
& CD-Rom-Laufwerk):
Wenn die relative Geschwindigkeit des Laserstrahls über der Pitspur
konstant ist, spricht man vom CLV. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der CD nimmt
hierbei von innen nach außen ab. Die Datentransferrate bleibt somit über die
gesamte CD-Spielzeit konstant. Diese Technik wendet man in Audio-CD-Playern an.
Dagegen drehen sich manche CD-Rom-Laufwerke - ähnlich wie Festplatten - mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit. Dabei dreht die CD immer gleich schnell.
Dadurch nimmt die Datentransferrate von innen nach außen zu. Diese Technik
nennt man CAV.
Mit immer schnelleren CD-Rom-Laufwerken ergibt sich aus der CAV-Technologie
jedoch folgendes Problem: wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit der CD zu hoch ist,
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Lesefehlern. Wählt man hingegen eine
niedrigere Umdrehungsgeschwindigkeit, verschenkt man Performance. Der Kompromiss
heißt PCAV. Im inneren Bereich der CD (Start des Lesevorgangs) bleibt die
Umdrehungsgeschwindigkeit wie beim CAV konstant. Im äußeren Bereich bremst die
CD allmählich ab, so dass die Datentransferrate dann wie beim CLV konstant
bleibt.
3.2 Das optische System:
Der Strahl eines Halbleiter-Lasers
tastet die Informationsspur auf der CD - wie nun folgend erklärt - ab. Der Strahl
hat den Vorteil, dass er berührungs- und damit verschleißfrei für das Medium
ist. Dieses ist neben denen in „Die
Compact Disc“ (2.1) genannten Spezifikationen
ein weiterer großer Vorteil gegenüber anderen Datenträgern, wie z.B. der LP,
die leicht durch die Tonabnehmernadel verschleißt.
Ein Halbleiterlaser erzeugt den nötigen Laserstrahl mit einer Wellenlänge von
780 nm. Das Beugungsgitter fächert den Strahl auf. Dann passiert er einen
halbdurchlässigen Spiegel. Dahinter befinden sich noch zwei Linsen: die erste,
eine Sammellinse (Kollimator), parallelisiert den Strahl; die zweite, eine
Fokussierungslinse, konzentriert den Strahl, so dass er beim Auftreffen auf die
CD-Oberfläche nur einen Durchmesser von ca. 0,8 mm (= 800 µm) hat. Dort wird
der Laserstrahl dann gebrochen. Der Grund dafür liegt im Lichtbrechungsindex
von 1,55 des Trägermaterials, der höher ist als der von Luft mit 1,0. Die
Brechung des Strahls bewirkt eine Bündelung und somit eine Verkleinerung des
Strahldurchmessers von 800 µm (CD-Oberfläche) auf letztendlich 1,7 µm, wenn
er schließlich auf die Datenspur / Pitspur trifft (1,7 µm entsprechen ungefähr
der dreifachen Pitbreite. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Staub und
Kratzer (auf der CD-Datenseite), die kleiner als 0,5 mm sind, keine Lesefehler
des Laufwerks nach sich ziehen!).
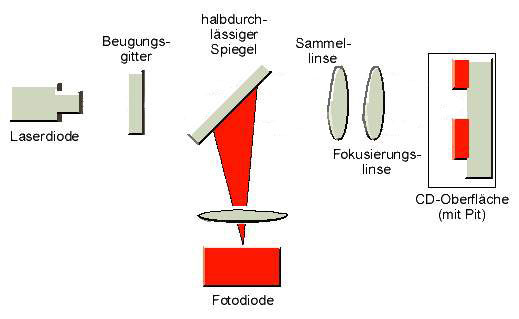

Trifft der Laserstrahl in der Datenspur auf ein Pit, muss er wegen der Pittiefe
eine längere Strecke zurücklegen als bei einem Land. Die Differenz der Strecke,
die der Laser zurücklegen muss, entspricht ungefähr der halben Wellenlänge (Zeichen
für Wellenlänge: l
- „Lamda“; Einheit: [mm]) des Strahls. Dadurch löschen sich die von den Pits
und Lands reflektierten Strahlen über Interferenz
teilweise aus.